Teurer Spaß: Werden deine Gutscheine als E-Geld eingeordnet?
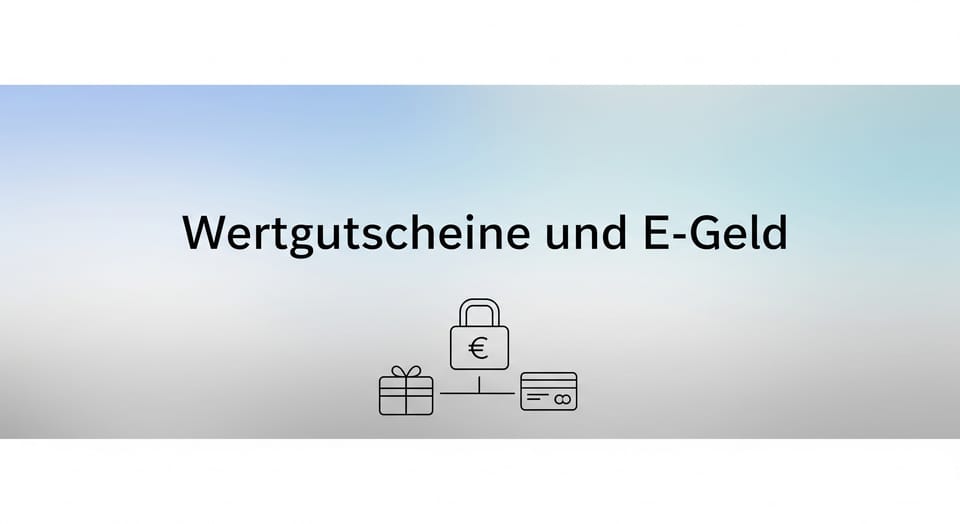
Wertgutscheine sind für viele Gastronomen das Mittel der Wahl. Oft gibt es auch die Idee von mehreren Lokalen oder Einzelhändlern, sich zusammenzutun und einen „City“-Gutschein in kleineren Städten zusammen auszugeben. Marketing für alle Beteiligten zusammen. Oder im Gastronomie-Fall als Plattform Gutscheine für mehrere Restaurants oder Bars auszugeben, die ich überall einlösen kann.
Hört sich toll an – kann dich aber deine Existenz kosten.
Denn bei mehreren Annahmestellen und/oder schlechten AGBs für dein oft digitales Gutscheinsystem, kann es sein, dass die Behörden dein Gutscheinsystem als E-Geld einordnen.
Was ist E-Geld?
E-Geld (elektronisches Geld) ist ein digitaler Ersatz für Bargeld. Es wird auf einem elektronischen Datenträger gespeichert und dient als Zahlungsmittel. Ein typisches Beispiel ist das Guthaben auf einer Prepaid-Karte, das bei verschiedenen Akzeptanzstellen ausgegeben werden kann. Gutscheine hingegen sind in der Regel für den Kauf von Waren oder Dienstleistungen bei einem bestimmten Händler (Ein-Zweck-Gutschein) oder einer begrenzten Gruppe von Händlern (Mehr-Zweck-Gutschein) vorgesehen. Die Problematik entsteht, wenn ein Gutschein so flexibel wird, dass er die Kriterien von E-Geld erfüllt.
Die Hauptgefahren und Kriterien Die Hauptgefahr liegt in der Ausweitung der Einlösemöglichkeiten und der Art des Guthabens. Folgende Kriterien spielen eine entscheidende Rolle, ob ein Gutschein als E-Geld eingestuft wird:
- Einlösekreis
- Gefahr: Ein Gutschein wird als E-Geld eingestuft, wenn er bei einer sehr großen und unbegrenzten Anzahl von Akzeptanzstellen (z. B. eine ganze Einkaufsstraße, ein bundesweites Netzwerk) oder für eine sehr breite Palette von Waren und Dienstleistungen eingelöst werden kann.
- Hintergrund: Ein klassischer Gutschein ist an einen oder wenige Händler gebunden (z. B. ein Gutschein für ein bestimmtes Restaurant). Je mehr Händler ihn akzeptieren, desto mehr ähnelt er einer Währung.
- Auszahlung in Bargeld
- Gefahr: Wenn Gutscheine in Bargeld ausgezahlt werden können, also eine Auszahlung des Guthabens möglich ist, wird dies als starkes Indiz für E-Geld gewertet.
- Hintergrund: Ein normaler Warengutschein ist nicht dazu gedacht, in Bargeld umgetauscht zu werden, sondern den Kauf von Produkten zu ermöglichen.
- Übertragbarkeit und Handelbarkeit
- Gefahr: Wenn das Gutscheinguthaben einfach von Person zu Person transferiert werden kann (z. B. per App-Funktion) oder auf Sekundärmärkten gehandelt wird.
- Hintergrund: Gutscheine sind primär für den Endverbraucher bestimmt und nicht als umlauffähiges Zahlungsmittel.
- Flexibilität und breites Angebot
- Gefahr: Wenn das Guthaben nicht an bestimmte Produkte oder Dienstleistungen gebunden ist und für nahezu alles im Sortiment des Händlers oder des Netzwerks verwendet werden kann.
- Hintergrund: Ein reiner Warengutschein (z. B. „Gutschein für ein T-Shirt“) wird seltener als E-Geld gesehen als ein „Wertgutschein“ (z. B. „Gutschein im Wert von 50 €“), der für das gesamte Sortiment gültig ist.
Warum ist die Einstufung als E-Geld so gefährlich? Wenn Gutscheine als E-Geld eingestuft werden, hat das weitreichende und teure Folgen für den Emittenten:
- Erlaubnispflicht: Das Ausgeben von E-Geld erfordert eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das ist ein langwieriger und kostenintensiver Prozess, der für ein normales Unternehmen kaum machbar ist.
- Eigenkapitalanforderungen: E-Geld-Institute müssen über ein ausreichendes Eigenkapital verfügen, um die Risiken abzudecken.
- Sicherung der Kundengelder: Der Emittent muss die Gelder der Gutscheininhaber sichern, zum Beispiel durch die Anlage auf einem Treuhandkonto bei einer Bank. Das bedeutet, das Gutscheinguthaben darf nicht einfach als normales Betriebsvermögen verwendet werden.
- Berichtspflichten: Es bestehen umfassende Prüf- und Berichtspflichten gegenüber der BaFin.
Was kann man tun, um die Einstufung als E-Geld zu vermeiden? Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Gutschein-Emittenten folgende Aspekte beachten:
- Begrenzung der Akzeptanzstellen: Der Gutschein sollte auf eine überschaubare und klar definierte Gruppe von Händlern beschränkt sein (z. B. alle Geschäfte in einem bestimmten Einkaufszentrum).
- Ausschluss der Barauszahlung: In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sollte klar festgehalten sein, dass eine Auszahlung des Gutscheinwerts in bar ausgeschlossen ist.
- Fokussierung auf bestimmte Waren/Dienstleistungen: Wenn möglich, sollten Gutscheine nicht als allgemeiner Wertgutschein, sondern für spezifische Produkte oder Produktgruppen ausgestellt werden.
- Keine Übertragungsfunktion: Es sollte keine technische Möglichkeit geben, das Guthaben einfach digital an andere Personen zu übertragen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gefahr, dass ein Gutschein als E-Geld eingestuft wird, steigt, je mehr er einer allgemeinen Währung ähnelt. Ein klassischer Ein-Zweck-Gutschein für ein bestimmtes Geschäft ist in der Regel unkritisch, während ein universell einlösbarer „City-Gutschein“ für eine ganze Stadt ein höheres Risiko birgt. Die Konsequenzen, wenn ein Gutschein als E-Geld eingestuft wird, sind weitreichend und können ohne entsprechende Erlaubnis zu einem illegalen Geschäftsbetrieb führen.
Hört sich alles wild an. Aber es ist sinnvoll, darüber nachzudenken. Gute AGBs helfen hier sicherlich für eine deutliche Abgrenzung.
Haftungsausschluss: Ich bin kein Steuerberater oder Rechtsanwalt. Dieser Text dient der Anregung. Für verbindliche Beratung kontaktiere die Profis, für außergewöhnlich gute und etwas zu starke Drinks, komm ins Le Lion.